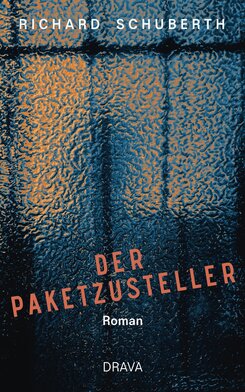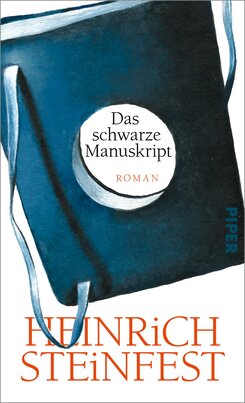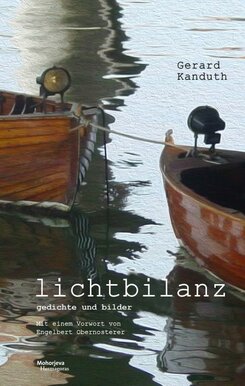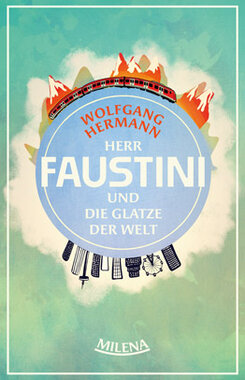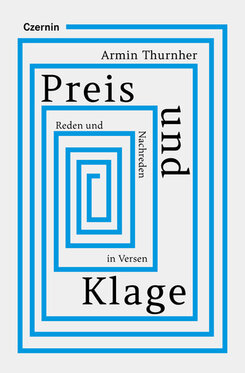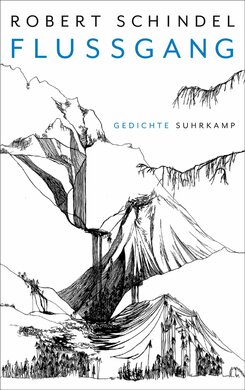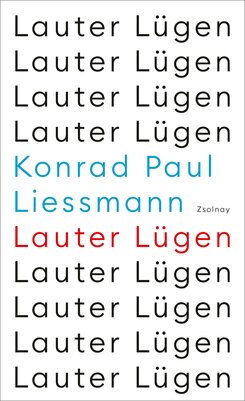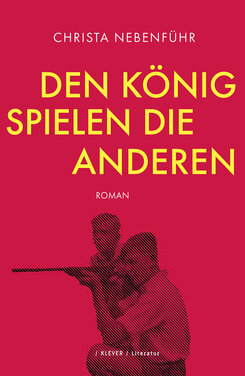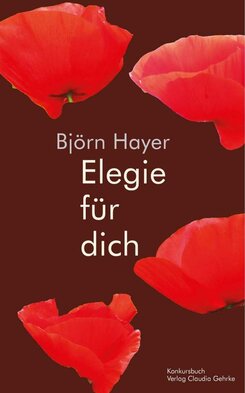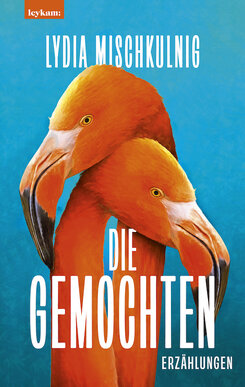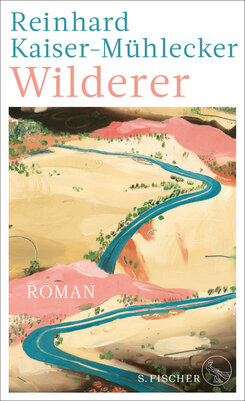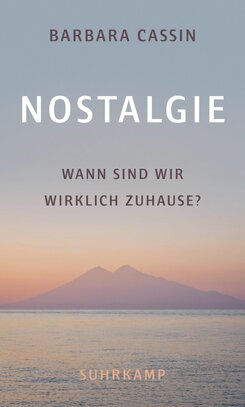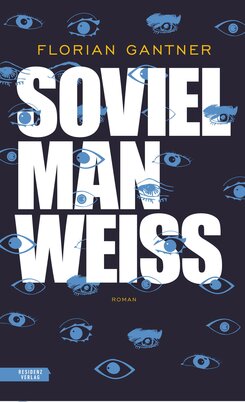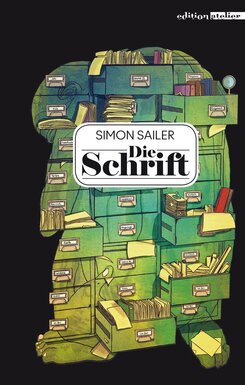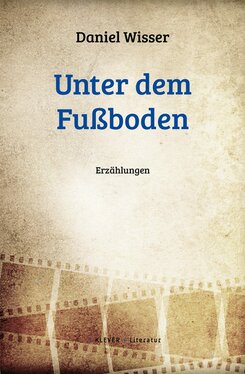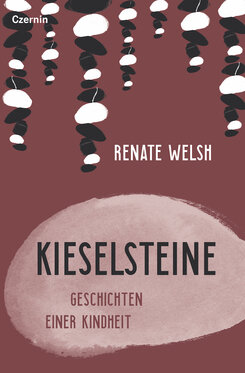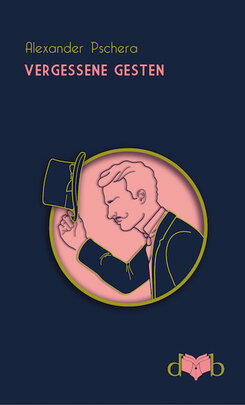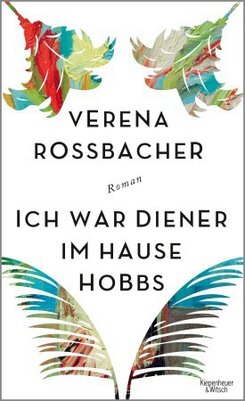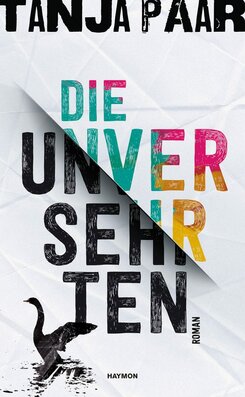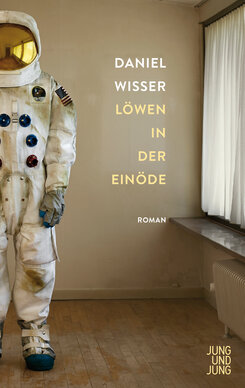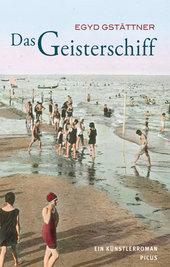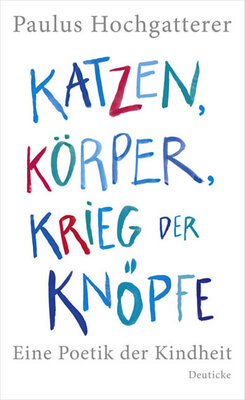Demaskierung der Online-Alter Egos
Richard Schuberth Der Paketzusteller
rezensiert für das Literaturhaus Wien
Spielerisch baut Schuberth falsche Fährten auf und balanciert eine Geschichte auf dem schmalen Grat tragikomischer Kippbilder aus, die in ihrer grotesken Zuspitzung gar einen dezent fiktionalisierten Bestsellerautor namens Richard Melasse einbezieht, der ebenso als Paketzusteller in Günter-Wallraff-Manier Hinterhof-Recherche betreibt, seinen Text darüber aber monatelang schuldig bleibt. Der Roman geizt nicht mit neologistischen Bausteinen wie „Abspritzagonie“ oder „Präventiventfriedungen“, aus denen das digitale Haus unserer Gesellschaft errichtet wird.
Genre-Mix
Heinrich Standfest Das schwarze Manuskript
rezensiert für die Literaturhaus Wien
Kenner des Krimi-Genres kommen wohl auf den Gedanken, dass man es bei dem titelgebenden Manuskript mit einem „McGuffin“ zu tun zu haben könnten. Dieses vor allem von Alfred Hitchcock eingesetzte Stilmittel löst eine dramatische Handlung aus oder treibt sie voran, aber steht tatsächlich gar nicht im Zentrum des Geschehens. So will im Hitchcock-Thriller North by Northwest (1959, dt. Der unsichtbare Dritte) ein Krimineller Informationen auf Mikrofilm außer Landes bringen, von denen wir jedoch nie erfahren, welcher Art diese Informationen sind und warum es der CIA ein so dringliches Anliegen ist, sie in ihren Besitz zu bekommen. In einer Paraphrasierung von Kants bekannter Idee aus der Kritik der reinen Vernunft, lässt sich feststellen: Das Ding an sich ist völlig nebensächlich.
Zum Schärfen des Blicks
Gerard Kanduths lichtbilanz
rezensiert für die Poesiegalerie
In einer der Poesie fernen Arbeitswelt kann einem das Schicksal leicht drohen, dem literarischen Schreiben vollkommen abhanden zu kommen. Umso wichtiger ist die Pflege der Mnemosyne, da sie in der Antike nach Hesiod die Mutter der neun Musen war. Gerade die Lyrik selbst schafft in Gestalt der Muse Euterpe eine unverzichtbare Pflege des Erinnerns; wörtlich heißt sie „die Erfreuende“. Die Bände von Kanduth zeichnet Prägnanz aus und die Freude am sprachlichen Spiel, das allerdings keine Kapriolen schlägt, sondern durch Reduktion bestimmt ist. Viele Texte sind Aphorismen oder Sentenzen, die mit Verve eine bestimmte Erwartung unterlaufen oder eine unverbrauchte Perspektive schöpfen. (...) Schon das erste Gedicht berichtet gekonnt von einem Minidrama:
optimierung vor lauter / landkarten lesen / ganz / auf die / abreise / vergessen
Ein sympathischer Zaungast lässt sich nieder
Wolfgang Hermann "Herr Faustini und die Glatze der Welt"
rezensiert fürs Literaturhaus Wien
Die Geschichte beginnt nach einem apokalyptischen Bericht über abgeholzte Wälder in Alaska mit einem Blick in den Himmel. Während Faustini dank dieser Perspektive einen Hauch Unendlichkeit atmet und der Perseidenschauer milde Erhabenheit spendet, so schreckt seine Begleiterin vor diesem Blick ins Universum zurück. Für sie lässt sich das Unfassbare schwer ertragen. Mit einer einzigen Szene entsteht ein Bild von Zugehörigkeit und Einsamkeit. Das Alleinsein ist Faustini gewohnt, aber er weiß auch, es zu meiden. Er findet ein erweitertes Wohnzimmer in der Bücherei, wo ihm mit Michael Endes Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ein seit langem vertrautes Familienmitglied begegnet und bei ihm bleibt. Doch auch trotz Jim Knopf ist es im stillen Heim eben das Gegenteil: unheimlich. Denn „das Tropfen eines schadhaften Wasserhahns ist das einzige Lebenszeichen weit und breit.“
Emsiger Essayist als diszipliniert Dichter
Armin Thurnher "Preis und Klage: Reden und Nachreden in Versen"
rezensiert fürs Literaturhaus Wien
Im Untertitel warnt das Buch Lesende, worauf sie sich einlassen: Reden und Nachreden in Versen heißt es da und man mag nicht recht daran glauben, ehe man diese Hymnen vernimmt. Der emsige Essayist und der kompromisslose Kolumnist als disziplinierter Dichter?! Es macht strategisch Sinn, denn in öffentlichen Reden der Würdigung muss die Rhetorik ihre ganze Kraft aufbieten. Das gelingt diesen Texten kongenial, auch wenn minimal invasive Eingriffe an manchen Stellen den Hexameter testend prüfen, um der Aussage das Vorrecht über die Form zu geben. Aus gutem Grund haben die alten Griechen erkannt, dass die Melodie eines Textes einen entsprechend gewichtigen Einfluss auf das Echo hat; die umtriebige, tragische Nymphe, deren Sprachmacht nach Strafe verloren ging. Nur ihr Widerhall blieb. Aber genau den gilt es zu bewahren in einer Zeit tönender Vielstimmigkeit. Der so zelebrierte Preisgesang unterscheidet sich damit wohltuend von der krächzenden Stimme verführerischen Stammtisch-Parlandos.
Bange Stunden im All
Fedor Pellmann "Nur noch den Abend erreichen"
erschienen in der Poesiegalerie am 27. Februar 2024
Eines dieser Gedichte nennt sich „Yucatán“ und übt die Perspektive einer Art, die vor uns das Aussterben zu lernen verstanden hat. Bekanntlich fällt das Ende der Dinosaurier in das fünfte Massenaussterben vor etwa 66 Millionen Jahren. In besagter Region des heutigen Mexiko hat ein folgenschwerer Asteroid eingeschlagen, der letale Arbeit geleistet hat. Im Verbund mit erhöhtem Vulkanismus war die Ära der Saurier besiegelt. In Pellmanns Gedicht „Yucatán“ erzählt uns ein Tlatolophus galorum – ein allem Anschein nach friedliebender Pflanzenfresser –, wie er gleißendes Licht erblickt und sich auflöst. Zurück bleibt sein Bild im Stein.
Verflüchtigung, das Aufheben eines identifizierbaren Ichs und Isolation – das trifft auch auf die voneinander abgekapselten Menschen dieses Bandes zu. Zu dieser Vereinzelung trägt die Materialität des Industriezeitalters entscheidend bei, die in diesem Band ein Kontinuum darstellt. Jetzt spricht man nicht nur vom Klimawandel und der Erschöpfung des Planeten, man benennt das Anthropozän als eine Epoche des sechsten Massenaussterbens. Werden wir die Krönung dieses Massenaussterbens sein?
Ins "Geschnarch vergangener Zeiten"
Robert Schindel "Flussgang"
erschienen im Buchmagazin des Literaturhauses Wien
Viele Gedichte dieses Buchs weisen auf einen aufrechten Gang hin, ganz im Sinne einer politisch engagierten Dichtung. Hier wird Unrecht benannt. Gräueltaten sollen vor dem Vergessen bewahrt sein – denn der Fluss der Zeit nimmt eben auch dieses Erinnern an Unrecht mit, das Wasser der Zeit fließt gnadenlos. Gerade daran lässt sich jedoch das gelungene, nicht durch geistige Osteoporose schon vor dem Ende gebrochene Leben bemessen, wenn trotz dieses endlosen Mäanderns die Unterscheidung von Gut und Böse gelingt.
Gleichzeitig irrlichtert durch das Buch eine harlekinöse Tonalität. Es spricht einer, der zwar den unvermeidbaren Verlust körperlicher Souveränität beschreibt, aber sich clownesk dagegen wehrt und als Schalk seine Vitalität sichert. Aus diesem Lebenselixier spitzbübischer Überdrehtheit schöpfen diese Gedichte ihre Einfälle sowie ihre Form. So naschen Lesende am frech-frivolen Nektar.
Vademecum gegen chronisches Aufregen
Konrad Paul Liessmans "Lauter Lügen"
erschienen in Literatur und Kritik 579/580 im November 2023
Vor gut zwanzig Jahren erschien Philosophie des verbotenen Wissens und manifestierte Konrad Paul Liessmanns Resultat einer überbordenden Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsches Philosophie. Der Titel selbst entstammt einer Aufzeichnung aus dem Nachlass dieses Paradephilosophen des Unzeitgemäßen. In dem vielleicht wichtigsten Nietzsche-Band Jenseits von Gut und Böse, der das vorher Gedachte ordnet und den dämmernden Größenwahn noch geschickt abzuwehren versteht, findet sich diese elegante Passage: „Ist es denn nicht erlaubt, gegen Subjekt, wie gegen Prädikat und Objekt, nachgerade ein wenig ironisch zu sein? Dürfte sich der Philosoph nicht über die Gläubigkeit an die Grammatik erheben?“
Stimmig findet sich dieser Einwand in einer Passage, die unterstellt, dass es ein moralisches Vorurteil sei, die Wahrheit für wertvoller als den Schein zu betrachten.
Einladung zur Enthauptung
Christa Nebenführ "Den König spielen die anderen"
erschienen in der Wiener Zeitung vom 27. Mai 2023
Mehrmals ist in diesem Buch von einem faradayschen Käfig die Rede. Die geschlossene Hülle, die damit gemeint ist, beschreibt in der Physik eine Abschirmung elektrostatischer Felder. Weder hat so ein Blitz von außen eine Wirkung auf jene, die sich im Käfig befinden, noch vermag eine Entladung, die im Käfig stattfindet, nach außen zu dringen.
Tolstois berühmter Befund, wonach jede unglückliche Familie auf ihre eigene Weise unglücklich sei, stellt in Abrede, dass gerade im scheinbar unverwechselbaren Abgrund toxischer Abhängigkeit etwas Exemplarisches steckt. Es steckt auch etwas Exemplarisches über Größe und Fall des Patriarchen in diesem Buch. Der Titel stellt fest, dass keiner allein König sein könne. Erst durch die Unterwürfigkeit anderer und die Claqueure wird jener erkennbar, welcher der König ist.
Epiphanien des Abschieds
Björn Hayers "Elegie für dich"
erschienen in der Wiener Zeitung vom 1. Oktober 2022
Es braucht Mut, um ein Buch wie dieses zu schreiben: Björn Hayer legt mit „Elegie für dich“ eine poetische Durchdringung des Abschieds vor. Die symbiotische Beziehung zu Emilia, ebenfalls eine Schreibende, ist zuende. Mit ganzer Verve wendet sich diese Klage dem Schmerz zu. Doch das Requiem auf die Verstorbene erstarrt nicht in wehmütigen Gesten, sondern schöpft aus dem Verlust eine Kraft überbordender Erinnerung und reflektierender Biografiearbeit. Der Sog, der dabei entsteht, ermuntert dazu Abschieden nachzuspüren. Als würde dieser exemplarische Abschied anderen zurufen: Versteckt euch nicht in der Banalität eines Alltags! Schon im ersten Absatz heißt es: „die Fenster haben aufgehört, Geschichten zu erzählen.“ Der Erzähler weiß um seinen fehlenden Ausblick, seine Verschlossenheit. Er macht dem Leser nichts vor, sondern stimmt ihn auf die Innenschau ein.
Die Neurosenkuss-Maschine
Lydia Mischkulnigs Erzählband "Die Gemochten"
erschienen in Buchmagazin des Literaturhaus Wien September 2022
Das Bild des Ariadnefadens gilt für alle diese zweifelnden und verzweifelnden Personen in Mischkulnigs Potpourri. Sie alle versuchen einem Minotaurus zu entkommen. Sie sind in ihren schicken, urbanen Lebenswelten zweifelsfrei prädestiniert fürs Unglück. Es liegt auch an ihrer Gabe zur Wahrnehmung. Denn diese erst nährt die Ambivalenzen. „Man kann die Staublunge bezeichnen und den Lungeninfarkt der verstorbenen Gattin erinnern, während man eine Reisstrohmatte betrachtet, ohne den Vorgang dieser Assoziationskette zu kapieren“, steht auf Seite 141 und vermittelt die assoziativen Rittberger anschaulich. Meist sind es sogar doppelte Rittberger. (...)
Selbst wenn wir bei Mischkulnig bereits wissen, dass in jeder Paradiesmaschine eine Neurosenkuss-Maschine steckt, dann betrachten wir die prometheische Scham – um es mit Günther Anders zu sagen – gelassener und können bei unserem Untergang wenigstens lachen.
Chronische Unruhe
Reinhard Kaiser-Mühleckers Roman "Wilderer"
erschienen in Buchmagazin des Literaturhauses Wien Frühjahr 2022
Das Personal in Reinhard Kaiser-Mühleckers Roman 'Wilderer' ist unheimlich vertraut. Schon im 2016 erschienenen 'Fremde Seele, dunkler Wald' ist es der Jungbauer Jakob mit seiner Familie, für welche das Prädikat dysfunktional fast beschönigend erscheint. Um es mit dem berühmten Tolstoi-Aphorismus zu umschreiben, ist die hier geschilderte Familie unglücklich auf ihre eigene oberösterreichische Weise. Wenn Unglück nicht bloß als Definition eines Ereignisses verstanden wird, sondern als beklemmendes Lebensgefühl, würde der Protagonist Jakob dafür eine Idealbesetzung darstellen. Es ist eine chronische Unruhe in ihm. Diese lädt sich an den Umständen wieder und wieder auf, findet mühelos Nahrung in nebensächlichen Geschehnissen und bricht im Jähzorn aus. (...) Kaiser-Mühlecker hat seine eigene Stoßrichtung, ein fast biblischer Sog des Unausweichlichen zieht sich durch seine Bücher, wenn das dünne Tuch der Zivilisation weggeschoben wird.
Heimweh wie ein Schweizer Gardist
Barbara Cassin sucht in ihrem Essay "Nostalgie" nach der Conditio humana.
erschienen in "Die Presse" - Spectrum am 15. Jänner 2022
In Giorgio de Chiricos 1968 entstandenem Ölgemälde "Il ritorno di Ulisse" sehen wir einen im Ruderboot paddelnden Odysseus auf einer Wasserlache, die sich in einem behaglich eingerichteten Zimmer befindet. Der Meister der metaphysischen Malerei bringt so plakativ die Ambivalenz des Begriffs "Nostalgie" zum Ausdruck. Die griechische Wortbedeutung des "schmerzenden Heimwehs" nimmt die Altphilologin und Philosophin Barbara Cassin zum Anlass einer kulturellen Reise. Ausgehend von der vielfach zitierten Irrfahrt des listigen Griechen über das Grundepos des Exils - die Aeneis -, ankert die Französin schließlich bei einer der engagiertesten Intellektuellen und Vertriebenen des 20. Jahrhunderts: Hannah Arendt und ihrem Postulat der Heimat, die keines Bodens bedarf, der Muttersprache. Wenn wir uns dieser Tage eine Rückkehr in das normale Leben nach der Pandemie erhoffen, so gleicht unsere Befindlichkeit jener des Odysseus. Man träumt vom Ankommen; ist es dann da, erwartet uns zu oft das Unheimliche, das allzu vertraute Schreckliche des Alltags.
Fremdbestimmung und Misstrauen
zu Florian Gantners "Soviel man weiß"
erschienen in der Wiener Zeitung am 13.11.2021
Das Wissen beruhigt die Protagonisten in Gantners Buch „Soviel man weiß“ nicht. Im 10ten Wiener Bezirk ist dieser Großstadtroman angesiedelt, exakt an der Quellenstraße 63. Hier begegnet uns ein Ensemble an Figuren, das auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnte: Das Paar Agnes und Gernot, beide erfolgsorientiert in ihren Berufen und gewiss einer selbstbestimmten Zukunft, der Albaner Illir Zerai mit seiner enervierenden Vergangenheit als Spitzel, Mirjam die 40-jährige, die ihrem Punkdasein nicht entsagen konnte und beinahe aus folkloristischer Motivation heraus Teil einer Widerstandsgruppe ist, deren Schicksal auch darin besteht, für die ganz große Geschichte zu spät gekommen zu sein. Schließlich Marek, der verbummelte Student. Das Misstrauen ist der Faden, der diese Geschichten verbindet. Gantner beweist Feingefühl für Details, denn seine Figuren gehen einem nahe dank ihrer anschaulichen Interpretation dessen, was um sie geschieht.
Setze bloß kein Zeichen
zu Simon Sailers "Die Schrift"
erschienen in der Wiener Zeitung am 19.9.2020
Ich vermute, Umberto Eco hätte dieses Bändchen geliebt. Simon Sailer leistet in seinem zweiten Buch eine tragikomische Hommage an Zeichensysteme aller Art. Man muss kein Semiotiker sein, um diese Novelle zu entschlüsseln - ein solcher kann man jedoch werden.
Als Berufsleser neigt man dazu, Texten allgemein allerlei Anspielungen und unterlegte Bezüge zu attestieren. Bei Sailers "Die Schrift" kann der verbildete Leser gleich mit dem Namen der Hauptfigur eine solche Vermutung wagen. Dr. Leo Buri ist Ägyptologe und ein ausgewiesener Fachmann auf seinem Gebiet. Bereits zu Beginn streut der personale Erzähler Zweifel am Status des Wissenschafters. In der nordischen Mythologie ist Búri der Stamm-vater aller Götter. Die sprachliche Herkunft des Namens ist das urgermanische buriz, das Sohn oder Geborener bedeutet. Doch am Ende der Novelle weiß man nicht, ob Dr. Leo Buri tot ist oder womöglich nie gelebt hat.
Chroniken der Vergeblichkeit
zu Daniel Wissers "Unter dem Fußboden"
erschienen in der Wiener Zeitung
Ebenso liest man in fast allen Texten von eben nicht gemeisterten Herausforderungen, denen sich Menschen stellten, um Neues zu erfahren und Unbekanntes zu ergründen. Dabei entsteht ein pan horao, ein "Alles sehen" der Kulturgeschichte, denn sowohl Erfinder wie Entdecker, Liebeshungrige wie Sportler, Besessene wie Unscheinbare sind die Protagonisten dieses Erzählkosmos. Episch werden die Miniaturen allein dadurch, dass sie oft ein Schicksal en passant in eine historische Klammer einbetten, dass sie vom Verlust der Berufung genauso erzählen wie vom Finden dieser. Aber ist nicht genau das die Geschichtsbetrachtung, die uns erst die Augen öffnet?
Verstreute Erinnerungen
zu Renate Welsh' "Kieselsteine"
erschienen in der Wiener Zeitung
In vielen Märchen spielen Kieselsteine eine entscheidende Rolle, sie führen zu etwas und von etwas weg, sie verwandeln sich in Taschen zu etwas Kostbarem, sie stehen für Kleines das Großes enthält. „Kieselsteine“ nennt Renate Welsh zwölf Geschichten, die in einem bei Czernin erschienenen Erzählband vereint sind. Zahlreiche Kinder- und Jugendbücher hat die gebürtige Wienerin geschrieben, aber so weit vorgewagt in ihre eigene Kindheit wie in diesem Band hat sie sich vielleicht noch nie. Anstatt mächtig von Memoiren zu sprechen, sind die Kieselsteine dieses Bandes funkelnde Erinnerungen, die über die eigene Kindheit das Kolorit einer Epoche anschaulich werden lassen. (...)
Küss die Hand, Vergangenheit!
zu Alexander Pscheras "Vergessene Gesten"
Rezension für die Wiener Zeitung
Die Geste ist die kleine Schwester der Tugend. Während sich jedoch die Tüchtigkeit wichtigtuerisch gebärdet, agiert die Geste spielerisch. Nur so bewahrt sie ihre Leichtigkeit, durch welche sie betört. Alexander Pschera hat mit seiner Gestensammlung „Vergessene Gesten“ ein Panorama versammelt, das Handlungen ebenso sehr würdigt wie Redewendungen und Haltungen. Es ist ein Blick in ein zuweilen verschollen erscheinendes Gestern, das vermutlich auch Gestern ein Blick in ein Vorgestern war.
Dabei bettet der studierte Philosoph und versierte Medientheoretiker die einfache Handlung in eine größere Moral, die – und das ist das charmante Wesen dieses Buches – konkret wird und sofort erspüren lässt, welche Glücksgefühle und Errungenschaften mit Gesten verbunden sind, wenn man sie bloß ernst nimmt.
Eine Art ständiges Dräuen
zu Verena Rossbachers "Ich war Diener im Hause Hobbs"
Rezension für die Wiener Zeitung
Die vier Freunde sind zudem Repräsentanten unterschiedlicher Lebensentwürfe wie sie für die 90er Jahre bis zu unserer Gegenwart exemplarisch sein können: Einer vegetiert in Berlin dahin, einer macht sich auf spirituelle Suche, einer übernimmt eine Drogenberatungsstelle und einer wird eben zum blinden Knecht des Großkapitals. Üppigkeit ist eine Ingredienz dieses Erzählens, sie verdeckt gekonnt die Farblosigkeit des Erzählers. Der Schluss, dass dieser Diener – der sich erst langsam von seiner Unterwürfigkeit lossagen muss – nie wirklich aus der Provinz rausgekommen ist, ist zulässig. (...)
Wie verschachtelt hier die Motive für den Selbstmord sind, soll nicht verraten werden, denn diese sind mit den Fragen der korrekten Vaterschaft verknüpft. Dieser Plot ist das Prunkstück des Romans und verknüpft eine Vatersuche gleich über mehrere Generationen – so als wäre es immer unklar, wer wessen Vater ist?
Rasende Rachegöttinnen
zu Tanja Paars "Die Unversehrten"
Rezension für die Wiener Zeitung
Schon der Titel „Die Unversehrten“ lässt den Leser argwöhnen, dass ihm hier Protagonisten entgegen leben werden, die besonders versehrt sind. In der Tat weckt bereits das Präludium die Ahnung einer Tragödie, weil hier von einem ertrinkenden Kleinkind erzählt wird. Das nimmt diesem konzise konzipierten Text etwas von der Schockstarre, in die er dann doch zielstrebig führt. Am Ende nochmals gelesen, wandelt sich das Präludium zum beunruhigenden Epilog.
Die Geschichte beginnt als gewöhnliche Ménage à trois, mit einem Martin zwischen den Frauen Violenta (Vio) und Klara. Der Text verliert kaum eine Zeile, um Szenen detailliert auszugestalten oder gar Befindlichkeiten mehr Raum zu geben, das Drama spult sich rasant in ökonomisch gestalteten Miniaturen ab. Der große Begriff Drama verdient in Tanja Paars Debütroman eine eingehende Würdigung, denn die fokussierte und episch grundierte Handlung sowie die besondere Wertschätzung des knappen Dialogs beschleunigen den fatalistischen Sog. Bei Henry James findet sich der erhellende Gedanke: „Aus dem Charakter folgt zwangsläufig das Ereignis. Das Ereignis kennzeichnet den Charakter.“
Verharren in solider Stagnation
zu Daniel Wissers "Löwen in der Einöde"
Rezension für die Wiener Zeitung
(...) Um den zentralen Charakter Michael Braun gruppiert sich ein schmales, aber gut akzentuiertes Ensemble. Es findet die für das österreichische Fußballnationalteam geradezu traumatisierend erfolgreiche Fußball-WM 1978 ebenso einen Platz im schmalen Roman wie markante Medienereignisse und politische Meilensteine, beispielsweise die Abstimmung über die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf, die Entführung des Biermoguls Alfred Heineken, der Einsturz der Reichsbrücke, der durch einen Sturz in einen Brunnen verunglückte italienische Junge Alfredo Rampi oder der in einer Gefängniszelle 18 Tage lang vergessene Andreas Mihavecz, der nur dank der Kondensflüssigkeit an den Wänden überlebte; selbst das ist unglaubwürdig genug. Anhand dieser Beispiele entsteht eine biografische Klammer für die Hauptperson und eine Verortung des Gedächtnisses, die auf etwas Kollektives verweist.
Da spricht das Ding an sich
zu Gert Jonkes "Erwachen vom großen Schlafkrieg"
Rezension für das Buchmagazin des Literaturhauses
Die Stadt, die den Ort der Erzählung in Jonkes „Erwachen zum großen Schlafkrieg“ bildet, ist ein großes Ärgernis für konventionelle Stadtplaner. Kein Ding ist mit der ihm angedachten Rolle zufrieden, kein Stein bleibt auf den anderen. Ja, der Stein selbst ist entschieden unzufrieden damit, porös und statisch jahrelang an einer Stelle auszuharren. Die Auflösung der Physik geschieht in diesem Text des 2009 verstorbenen gebürtigen Klagenfurters Gert Jonke jedoch nicht durch öde Fantasy, sondern durch Poesie, durch eine Metaphorik, die an manchen Stellen vielleicht manieriert erscheint, aber in ihrer Akribie überzeugt. Die Bilder sind, wenn sie schon schief sind, dann eben solide schief, auch wenn sie sich weit hinauslehnen. In den allermeisten Fällen jedoch ist die Menschwerdung der Dinge geradezu körperlich beklemmend: „... die Dachstühle husten aus asthmatischen Kaminen, manche Gebäude niesen aus geöffneten Dachluken, dann und wann schiebt ein Haustor sein aus allen Treppen berstendes Stiegenhaus auf die Gasse, ...“
Die lange Reise ins Nichts
zu Egyd Gstättners "Das Geisterschiff"
Rezension für das Buchmagazin des Literaturhauses
Egyd Gstättner erzählt in seinem Roman jedoch nicht von den glanzvollen Jahren Auchentallers und seinem Aufstieg zu einem der Secessionisten. Er widmet sich vielmehr dem größeren zweiten Teil dieses Künstlerleben, einem Leben, das hauptsächlich im damals noch verschlafenen Grado stattfand und von Abschieden bestimmt zu sein schien. Dabei entwickelt Gstättner eine klug komponierte Fiction-in-Fact-Dramaturgie. Äußere Ereignisse und alle vorkommenden Personen sind eng an die Wirklichkeit gebunden. Die zentrale Figur jedoch, der erzählende Auchentaller selbst, ist notwendigerweise wesentlich ein Produkt der Imagination Gstättners. Verlässliche Belege zu Auchentallers Leben an der Adria gibt es kaum. Der Autor meinte in einem Interview mit der Kleinen Zeitung: „Was ich erfunden habe, habe ich immer genau an einer Bruchlinie der Realität erfunden.“
Der Text der Kindheit, geschrieben am Körper
zu Paulus Hochgatterer: Katzen, Körper, Krieg der Knöpfe
Rezension erschienen in der Wiener Zeitung 2012
Die Erfahrungen als Kinderpsychiater hat Paulus Hochgatterer nicht nur als Autor von Erzählungen und Romanen genutzt, sondern sie auch generell in Bezug zur Literatur gesetzt. Davon zeugen die im Herbst 2010 gehaltenen Zürcher Poetikvorlesungen des gebürtigen Amstettners, die den Kern seiner neuesten Publikation, den Band „Katzen, Körper, Krieg der Knöpfe“., ausmachen. Darin zu finden sind gleich mehrere Argumente für die Notwendigkeit über Kinder zu schreiben. Hochgatterer formuliert neun poetologische Grundfiguren, die Kind und Sprache in Verbindung setzen.